Suche

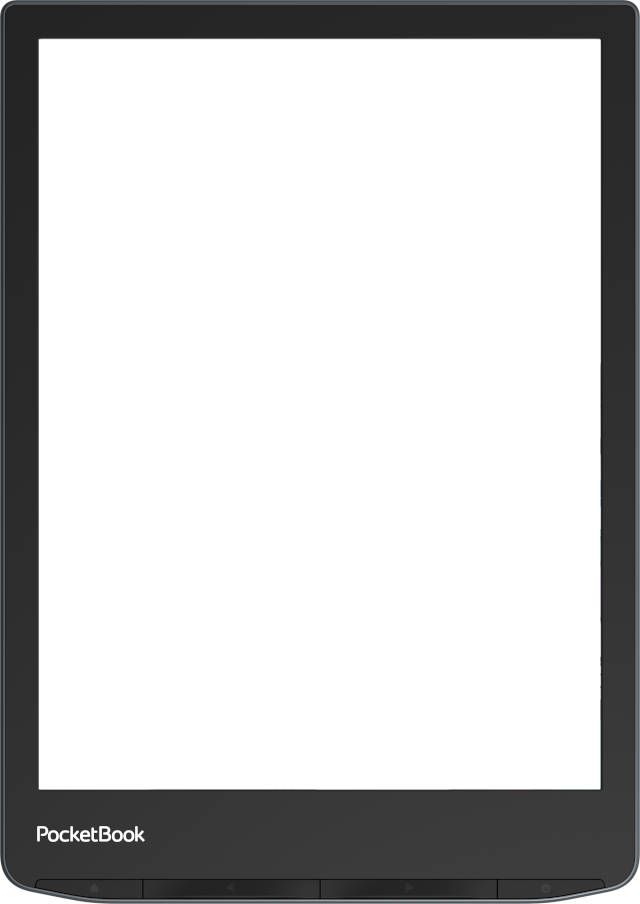
Nackter Mann, der brennt
E-Book (EPUB)
2016 Suhrkamp
Auflage: 1. Auflage
223 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-518-74798-8
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich
- Als Hardcover erhältlich
- Als Audio erhältlich
Wie aus Opfern Täter werden, in welcher Weise dieser unaufhaltsame, alle Grenzen der Grausamkeit sprengende Prozess abläuft - dies erzählt Friedrich Ani, der Meister des Noir, hochspannend, überraschend und einfühlsam.
Im Alter von vierzehn Jahren flieht ein Junge aus dem süddeutschen Dorf Heiligsheim. Vierzig Jahre später kehrt er als Ludwig »Luggi« Dragomir zurück: Alkohol, Drogen und alle gegen sich und die anderen ausgefochtenen Kriege in Berlin konnten die Erinnerungen an den Missbrauch seiner Spielkameraden und seiner selbst durch die Honoratioren von Heiligsheim nicht verdrängen. Die Schuldgefühle, seine Freunde nicht beschützt zu haben, treiben ihn an.
Seit seiner Anwesenheit verschwinden gleich mehrere ältere Herren, einige werden tot aufgefunden - ob durch Unfall oder Mord, das versucht Kommissarin Anna Darko herauszufinden. Dabei gerät auch Ludwig ins Visier, weil er ein Verhältnis mit der Ehefrau eines der Vermissten hat - den er als Gefangenen im eigenen Haus malträtiert. Denn in Ludwig Dragomir hat Wut die Oberhand erlangt, und nun »durfte sie brennen« ...
Friedrich Ani, geboren 1959, lebt in München. Er schreibt Romane, Gedichte, Jugendbücher, Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Sein Werk wurde mehrfach übersetzt und vielfach prämiert, u. a. mit dem Deutschen Krimipreis, dem Crime Cologne Award, dem Stuttgarter Krimipreis, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis. Friedrich Ani ist Mitglied des PEN-Berlin.
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Gelobt sei Jesus Christus, dachte ich, bekreuzigte mich und öffnete die Tür zur Abstellkammer, in der mein Gast geduldig seine Angst ausbrütete. Er starrte mich an, und ich schloss die Tür wieder. Der Tag versprach mir zu gefallen.
Als ich das Haus verließ, läuteten - zu Ehren des verstorbenen Apothekers Eduard Rupp - die Glocken der SanktMichael-Kirche. Das bedeutete, ich hatte mich verspätet. Niemand im Dorf erwartete mich bei der Zeremonie, aber wegen der alten Zeiten und der Sache im Wald fühlte ich mich verpflichtet hinzugehen.
Ich hatte meinen einzigen schwarzen Anzug und ein dunkles Hemd angezogen und eine schmale schwarze Krawatte umgebunden. Ich schaute in den Spiegel und kam mir vor wie ein Rockstar der sechziger Jahre. In einem Anfall kindischen Übermuts lief ich ins Wohnzimmer und holte meine marode Fender. Ich hängte mir die Gitarre um, posierte vor dem Spiegel, schlug mit dem Zeigefinger auf die Saiten, minutenlang, E-Dur, G-Dur, D-Dur, F-Dur - als probte ich einen Song, strumpfsockig, stumpfsinnig, stumm und mit verzerrtem Gesicht. Einer meiner Anfälle von gut geübter Lächerlichkeit.
Tatsächlich hatte Regina mich gefragt, ob ich nicht ein Stück auf der Beerdigung spielen wolle. Ich zierte mich eine Weile, um glaubwürdiger zu erscheinen. Dann verneinte ich und erklärte, der Respekt vor den Toten verbiete dilettantisches Klampfen am offenen Grab. Vermutlich war Regina die Einzige, die mich in der Kirche vermisste.
Den Kopf gesenkt, die Hände vor dem Bauch gefaltet, schloss ich mich der Trauergemeinde beim Verlassen des Gotteshauses an, nachdem ich eine halbe Stunde durch die Gräberreihen geschlendert war, in Erinnerungen schwelgend.
Von all den Gesichtern, dem Gebrüll der Stimmen, den Ausdünstungen der Körper, den peitschenden Händen und zutretenden Füßen, den triefenden Augen und sabbernden Mündern waren nur noch Namen übrig, teilweise verwaschen und verblasst, auf einem grauen, schwarzen, weißen oder braunen Stein, durchweg gepflegt, genau wie die unkrautlosen, gleichförmigen Vergissmeinnicht-Rabatten - ein Paradies der Menschenlosigkeit.
So war mir dieser Friedhof schon als Kind vorgekommen, und ich liebte und verehrte diesen Ort. Deshalb empfand ich es immer als eine Schande, dass der Vatikan mir seinerzeit keine Urkunde anlässlich meines zehntausendsten Besuches verliehen hatte.
»Da bist du endlich.« Die Stimme schrammte an meinem Nacken entlang. »Wieso bist du nicht in der Messe gewesen?«
Ich brauchte mich nicht umzudrehen. Der Geruch ihres Parfüms reichte aus, um mir ihr von verkrampfter Erwartung gezeichnetes Gesicht vorstellen zu können. Ihre Nähe am Tresen vermittelte mir jedes Mal eine Aura von Altersarmut. Wenn Regina mir das Glas hinschob oder ihr eigenes nahm und mir zuprostete, wirkten ihre knochigen Finger wie eingehüllt in gebrauchte Haut, die schon alt war, als Regina geboren wurde. Angeblich war sie vierundfünfzig. Neben der mindestens siebzigjährigen Witwe des alten Rupp ging sie als deren ältere Schwester durch - zumindest in meiner Vorstellung und dem schäbigen Tageslicht.
Während der Priester den aufgebahrten Sarg mit Weihwasser segnete und einer der beiden Ministranten das Weihrauchfass schwenkte - das Geräusch der Kette klang vertraut in meinen Ohren -, warf Regina mir Blicke zu, die sie unter ihrer schwarzen Schirmmütze für unauffällig hielt.
Wir waren in Heiligsheim. Jeder der dreitausend Dorfbewohner war mit Augen größer als Flutlichtscheinwerfer auf die Welt gekommen. Einige hatten sogar - Furunkel ihres verhunzten Erbguts - unsichtbare Nachtsichtgeräte auf der Stirn. Jeder hier sah alles.
So funktionierte die Schicksalsgemeinschaft in der Senke unterhalb des tausendvierhundertzweiundfünfzig Meter hohen Felsenkellers. Das erste Blinzeln eines Neugeborenen landete automatisch in der geheimen Datenbank eines jeden Mitbürgers, auf dass diesem kein Wimpernschlag entging, kein unerlaubt
